|
Die Feuerwehr, damals
und heute.
Lydia Aumüller
Zum Schutze der Bürger
bei Feuergefahren wurde der Nassauische Feuerwehrverband 1872 als erster
im Gebiet des heutigen Bundeslandes Hessen gegründet. Eine lange
Geschichte zeigt die Entwicklung des Feuerwehrverbandswesens durch
bewegte Zeiten auf. Dieser Verband führte seine Mitgliedsfeuerwehren
bzw. -verbände durch alle Staatsformen vom Kaiserreich, über die
Weimarer Republik und NS-Diktatur bis zur heutigen Demokratie
 Im
Jahr 2004 feierte die Freiwillige Feuerwehr Villmars ihr 75jähriges
Jubiläum Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr, Nassauischer
Feuerwehrverband", ist neben dem Emblem Hessischen
Feuerwehrverbandes auf einem schmucken Paradehelm ersichtlich. Er wird
in Erinnerung an die Kameraden, die vor 75 Jahren den Verein gründeten,
bis heute im Vereinshaus verwahrt. Im
Jahr 2004 feierte die Freiwillige Feuerwehr Villmars ihr 75jähriges
Jubiläum Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr, Nassauischer
Feuerwehrverband", ist neben dem Emblem Hessischen
Feuerwehrverbandes auf einem schmucken Paradehelm ersichtlich. Er wird
in Erinnerung an die Kameraden, die vor 75 Jahren den Verein gründeten,
bis heute im Vereinshaus verwahrt.
Der
anfänglich dürftige Bestand an Löschgeräten hat sich im Laufe der
Jahre enorm verbessert. Die Wehr ist im Besitz einer modernen
technischen Ausrüstung und damit einsatzbereit für den Notdienst am
Nächsten. Doch das hat, neben dem ehrenamtlichen Engagement der
Freiwilligen des Vereins, auch seinen Preis. Das  neue
Feuerwehrgerätehaus, das auch für Schulungszwecke dient, kostete um
700.000 Euro. Zum Inventar des Hauses gehören unter anderem
Löschfahrzeuge, Mannschaftswagen, ein Rettungsboot und Atem-
schutzgeräte, im Wert von ca.180.000 Euro. Über die Tätigkeiten
der Freiwilligen Feuerwehr Villmar von 1929 bis heute informiert eine
neue Jubiläumsbroschüre ausführlich in Wort und Bild. Dieselbe ist
für 3 Euro bei den Mitgliedern des Vereinsvorstandes erhältlich. neue
Feuerwehrgerätehaus, das auch für Schulungszwecke dient, kostete um
700.000 Euro. Zum Inventar des Hauses gehören unter anderem
Löschfahrzeuge, Mannschaftswagen, ein Rettungsboot und Atem-
schutzgeräte, im Wert von ca.180.000 Euro. Über die Tätigkeiten
der Freiwilligen Feuerwehr Villmar von 1929 bis heute informiert eine
neue Jubiläumsbroschüre ausführlich in Wort und Bild. Dieselbe ist
für 3 Euro bei den Mitgliedern des Vereinsvorstandes erhältlich.
Rückblick
Bis zum Jahre 1929
bestand zwangsläufig eine „Pflichtfeuerwehr". Aus Unterlagen des
Jahres 1555 sind namentliche „Feuerläufer" bekannt, die bei
Bränden und Stürmen im Flecken und in den Nachbarorten verpflichtet
waren, mit den gemeindeeigenen Löschgeräten Katastrophenhilfe zu
leisten. Wegen eines schrecklichen Brandes im Jahr 1536, in der fast die
ganze Stadt Villmar in Schutt und Asche fiel, wurde im Februar 1557 eine
neue Feuerwehrordnung erlassen.
Folgendes heißt es unter
anderem: Die Pförtner haben bei ihren Pforten zu bleiben und nicht nach
einer halben Nacht davon zu gehen. Es darf kein Flachs mehr im Flecken
Villmar geschwungen oder aufbewahrt werden bei Strafe von drei Gulden.
Es soll ein „gemein brech haus" vor dem Flecken errichtet werden,
um dort die feuergefährliche Arbeit des Flachsbrechens vorzunehmen.
Die ganze
Feuerwehrordnung war für die damalige Zeit eine großzügige
Organisation, denn hier ist zu erkennen, dass viele im Ort auch bei
Hilfen bedrohter Nachbarorte beteiligt wurden.
 Es
wurden namentlich 39 Feuerläufer bestimmt die 32 Leitern aus Buchenholz
innerhalb eines Monats hergestellten Zum weiteren Gerätebestand
gehörten, zwei Wagen, mehrere Ledereimer, acht Feuerstange und vier
Feuerhaken, die in Mainz gekauft wurden. Diese Löschgeräte lagerten im
„Spielhauß" ( Rathaus, das damals denselben Standort wie heute
hatte).Bei der Meldungen von Feuer- oder Sturmschäden, musste jeder auf
den Kirchhof (an der Kirche) laufen, wo ihnen ein Keller (Verwalter der
Kellerei) und der Bürgermeister die Order gab: „Sie sollen strack
nach dem Feuer laufen und uf den Amer acht haben." Sie sollen auf
den Jüngstbürgermeister achten und auf Josten hören. Andernfalls
erhalten sie die "gebürlich Straf", sie sollen bei den wägen
sein und die wägen helfen stellen und die Leitern helfen laechen
(legen) Zwei Wagen mit je 3 Leitern und die Feuerhaken fahren und
anlegen" Es
wurden namentlich 39 Feuerläufer bestimmt die 32 Leitern aus Buchenholz
innerhalb eines Monats hergestellten Zum weiteren Gerätebestand
gehörten, zwei Wagen, mehrere Ledereimer, acht Feuerstange und vier
Feuerhaken, die in Mainz gekauft wurden. Diese Löschgeräte lagerten im
„Spielhauß" ( Rathaus, das damals denselben Standort wie heute
hatte).Bei der Meldungen von Feuer- oder Sturmschäden, musste jeder auf
den Kirchhof (an der Kirche) laufen, wo ihnen ein Keller (Verwalter der
Kellerei) und der Bürgermeister die Order gab: „Sie sollen strack
nach dem Feuer laufen und uf den Amer acht haben." Sie sollen auf
den Jüngstbürgermeister achten und auf Josten hören. Andernfalls
erhalten sie die "gebürlich Straf", sie sollen bei den wägen
sein und die wägen helfen stellen und die Leitern helfen laechen
(legen) Zwei Wagen mit je 3 Leitern und die Feuerhaken fahren und
anlegen"
Es gab für besonderen
Einsatz auch eine Belohnung. Wer zuerst mit seinem Wagen am Brandherd
war, erhielt einen halben Gulden; der zweite Wagen dagegen 8 Albus.
Ferner wurde verordnet, dass sobald in Villmar ein Feuer ausbrach, jeder
bei "Leips straff und ungnadt unsers gnedigen Herren" zur
Brandstelle eilen musste. Er sei nur entschuldigt, wenn Feuergefahr ihm
selbst drohe".
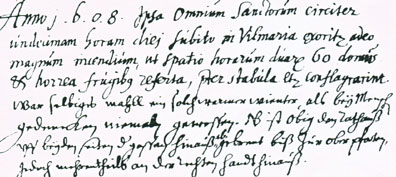 Trotz
aller Vorsichtsmaßnahmen brannte es im Jahre 1608. An Allerheiligen, 11
Uhr morgens wütete obig dem Rathaus an beiden Seite, jedoch meistens an
der rechten Seite bis zur Oberpforte ein großer Brand. Er entstand in
der Scheune des am 7. März ertrunkenen Schmiedes Aßmann. 86 Gebäude
fielen den Flammen zum Opfer, Kurfürst Lotharius half mit 20 Malter
Weizen, der Pastor mit drei Goldstücken, der Cellerarius Wilhelm
Lindner mit einem Doppeldukaten, die erste Not zu lindern. (Kb.III, S.6-
Hau S. 137) Trotz
aller Vorsichtsmaßnahmen brannte es im Jahre 1608. An Allerheiligen, 11
Uhr morgens wütete obig dem Rathaus an beiden Seite, jedoch meistens an
der rechten Seite bis zur Oberpforte ein großer Brand. Er entstand in
der Scheune des am 7. März ertrunkenen Schmiedes Aßmann. 86 Gebäude
fielen den Flammen zum Opfer, Kurfürst Lotharius half mit 20 Malter
Weizen, der Pastor mit drei Goldstücken, der Cellerarius Wilhelm
Lindner mit einem Doppeldukaten, die erste Not zu lindern. (Kb.III, S.6-
Hau S. 137)
Einem weiteren Feuer
durch Brandstiftung im Oberdorf ( heute Mattheisereck), fielen 13. Mai
1697 zehn Häuser und drei Scheunen zum Opfer, Bei den Löscharbeiten
stürzte Peter Eisenbach von einem Dach und verunglückte tödlich.(KB.
III , S. 16) Wahrscheinlich trug dies zur Strafverschärfung bei. Am 28.
Juni erfolgte, die Strafe für ihre Tat. Sie wurde enthauptet und
verbrannt. Ein Notiz hält fest:. 28. Junii decollata est et concremata
Anna Dorothea, Georgii Wilhelmi fischer, etc. Clarae Löwin coniugum
filia, Henrici Klötz uxor, quae supra dictum incendium malitiose
excitaverat ( DAL 588, KB Villmar, Liber Mortuorum, Bl. 148r, S.63 und
80).
Die 1675 geborene
Brandstifterin Anna Dorothea Klötz geborene Fische vermählte sich am
27. 9. 1694 mit Heinrich Klötz und gebar 1696 eine Tochter namens
Katharina. Kaum zu glauben. Diese junge Mutter steckte vermutlich das
Haus ihrer Schwiegermutter (1699 Wtw. Klötz genannt) an, das nahe der
Oberpforte (Limburgerpforte) stand. Ihr Ehemann Heinrich wird im Jahre
1702 als Tagelöhner ohne Haus genannt. Ihr Vater, Georg Wilhelm Fischer
wird imselben Jahr als „ein verdorbener Schweinehirt" erwähnt.
Großbrand 1699
 Zwei
Jahre später stand die Stadt Villmar abermals in Flammen. Mit Ausnahme
der sechs Häuser in der „Matttheiserecke", die nach dem vorigen
Brand 1697 wieder aufgebaut worden waren, der Kirche, der Kellerei und
dem Schulhaus wurden 105 Häuser zerstört, 62 Scheunen und ebenso viele
Stallungen ein Raub der Flammen. Zum Wiederaufbau der Häuser und
Scheunen und Stallungen, trat bereits 14 Tage später eine neue,
verschärfte Bauordnung in Kraft. Zwei
Jahre später stand die Stadt Villmar abermals in Flammen. Mit Ausnahme
der sechs Häuser in der „Matttheiserecke", die nach dem vorigen
Brand 1697 wieder aufgebaut worden waren, der Kirche, der Kellerei und
dem Schulhaus wurden 105 Häuser zerstört, 62 Scheunen und ebenso viele
Stallungen ein Raub der Flammen. Zum Wiederaufbau der Häuser und
Scheunen und Stallungen, trat bereits 14 Tage später eine neue,
verschärfte Bauordnung in Kraft.
Vergrößerung: anklicken
Die
Bauordnung vom 23. Mai des Jahres 1699
Ungefehrlicher
endtwurf waß bey jetzt wieder ufbawendt flecken der häuser, scheüren
und stallungen zu observiren.
1. Weilen
man bey letzterm wesenem brande leyder erfahren, daß die pudein oder
also genante weede wegen umb gelegener häuser so mit abgebrandt kein
wasser schier zum löschen dar auß zu nehmen gewesen, so ist für
dienlich und rathsamb befunden w(orden) daß von dem rathauß brunnen
und dasiger weeden der abfall biß ahn den pastorey garten ufder P. P.
von St. Mattheiß kosten geleytete und in der garten ecken ein weede und
da von ein für die pfarr kirch gemachte, und die dar für stehende baw
platzen sub lit. A. et B. et n. 60. 61. wie dergrundtriss außweiset
ledig pleiben. und daß geleydt biß (an) den garten gemeindt-schaftlich,
von dem garten ahn daß geleydt und die weede auf der gemeindt kosten
allein gemacht und unterhalten werden soll.
2. Die
Straßen wie selbige außgestochen, bis uf ferneren befehl sollen nicht
verbawet werden.
3.
Befindt sich 3tens vermag übergebener liste, daß mehr nicht alß 55
mann, deren ettliche doch wenig begütet und diese mehrentheilß daß
geldtzum baw lehnen müssen bawen können.
4. Diesen
kante man 4tens zu dem hause und scheuern umb ihre fruchten ein scheuern
zu können, daß nötige holtzzu adigiren, denen aber so zu bawen nicht
fähig und für 300 rhlr. keine caution findten können, und bereits
holtz gehawen, all solches nebst erstattung dieserth(eils) gehabter
kosten abgenohmen, und denen bau fähigen gegeben werden.
5. Nach
deme man erfahren, daß bereits einige ihr hauß und schäwer an: und
ineinander zu machen verdingt und hier durch ein baldiger brandtzu
befihren, so solle kein zimmerman
bey
arbiträr! straf dergleiche baw zu machen nicht unter nehmen waruf
Schultheiß und Vorsteher abhilf tragen, und wan einer gegen daß verbot
handtlen wolte all solche gebäw nicht ufschlagen lasse.
6. Alle
Schornstein von gebackenen oder sonst ändern steinen ufgefihret und
diezimmerleüth zu sehen (wollen) womit die wexel wohl ersehen und kein
holtz in die Schornstein gehe.
7. Sollen
keine strohe dächer vor fackeln, oder sonst raw dächer weder zum
behelf noch sonsten geduftet all solche von leyen, ziegel oder aber von
schindeln verfertiget werden.
8. Solle
kein holtz ferners gehawen werden, es were von Schultheißen, scheffen
und deputirten zu fore angewiesen und daß beyconfiscation deß holtzes
und hoher herrn straf.
9. Wan es
9tens ggst beliebet wirdt, daß die auß gestochene Strossen nach
gebawet würde, und hier durch (dem) ein und ändern etwaß endt-zogen,
und dem ändern zu wachse, solle dem leydeden der werth nach billig(keit)
guth gemacht, auch wan die zu r Strossen eingezogene platz etwa mitzins
befasset, demjenigen welchem hier durch etwas zu wachset all solche
über nehmen und zahlen.
10. Kein
dach einer scheuer oder stallung unter 20 schuh hoch auf zu richten, und
keins von beyden ahn die strass zu stellen.
11.
Keinem erlaubt sein ahn die statt mawer seinen baw zu stellen und ahn zu
hangen.
Obiges
ist bey versambleter gemeindten publizirt, dem Schultheiß und vor
Stehern befohlen worden beschriebener massen bey ihrer Verantwortung in
obacht zu nehmen, daß dar wieder nicht gehandtelt werde.
Vilmar
den 23ten May 1699 Coenen P. Ravesteyn
Wichtig war unter anderem
das Verbot, dass künftig keine Dächer mit Stroh gedeckt werden
durften.
Diese Maßnahme trug dazu
bei, dass Brände in größerem Umfang seit jenen Jahren nicht mehr
bekannt sind.
 120
Jahre später sah es mit den vorhandenen Löschgeräten der Gemeinde
immer noch mangelhaft aus. Der Villmarer Schultheiß Anton Ricker hält
im Jahre 1816 den damaligen Bestand an Löschgeräten und deren Wert wie
folgt fest: Eine große vierrädrige Feuerspritze mit Schwanenhals und
Schlauch im Wert von 500 Gulden, 22 lederne Feuereimer im Wert von 22
Gulden sowie eine Hand- und eine Tragspritze Gesamtwert von 80 Gulden.
Außerdem gab es zwei Pferdegeschirre für „Ackergäule", die den
Spritzenwagen an den Brandherd brachten. Fünf vorhanden Laternen waren
zum Ausleuchten von Straßen und Plätzen bei Feuergefahr bestimmt. Alle
genannten Gegenstände lagerten im Untergeschoss des 1702 erbauten und
1927 abgebrochenen Rathauses. Während sich am Eingang zu dem „Spritzenraum"
ein Laufbrunnen befand, war hinter dem Gebäude ein Wasserreservat (die
sogenannte Weede), dessen Speicherinhalt bei Großbränden nicht
ausreichte. Vier Feuerleitern und vier Feuerhaken, sowie drei Stangen im
Werte von 59 Gulden lagerten in einer Holzremise, die sich an der
Pfarrgartenmauer befand.„Diese ist so desolat. dass sie jederzeit
zusammenstürzen kann", so Schultheiß Ricker in seinen
Aufzeichnungen. Es dauerte zwei Jahre bis die Gemeinde einen neuen
Holzschuppen zur Unterbringung der Gerätschaften an 120
Jahre später sah es mit den vorhandenen Löschgeräten der Gemeinde
immer noch mangelhaft aus. Der Villmarer Schultheiß Anton Ricker hält
im Jahre 1816 den damaligen Bestand an Löschgeräten und deren Wert wie
folgt fest: Eine große vierrädrige Feuerspritze mit Schwanenhals und
Schlauch im Wert von 500 Gulden, 22 lederne Feuereimer im Wert von 22
Gulden sowie eine Hand- und eine Tragspritze Gesamtwert von 80 Gulden.
Außerdem gab es zwei Pferdegeschirre für „Ackergäule", die den
Spritzenwagen an den Brandherd brachten. Fünf vorhanden Laternen waren
zum Ausleuchten von Straßen und Plätzen bei Feuergefahr bestimmt. Alle
genannten Gegenstände lagerten im Untergeschoss des 1702 erbauten und
1927 abgebrochenen Rathauses. Während sich am Eingang zu dem „Spritzenraum"
ein Laufbrunnen befand, war hinter dem Gebäude ein Wasserreservat (die
sogenannte Weede), dessen Speicherinhalt bei Großbränden nicht
ausreichte. Vier Feuerleitern und vier Feuerhaken, sowie drei Stangen im
Werte von 59 Gulden lagerten in einer Holzremise, die sich an der
Pfarrgartenmauer befand.„Diese ist so desolat. dass sie jederzeit
zusammenstürzen kann", so Schultheiß Ricker in seinen
Aufzeichnungen. Es dauerte zwei Jahre bis die Gemeinde einen neuen
Holzschuppen zur Unterbringung der Gerätschaften an 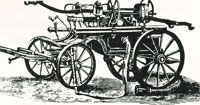 der
Lahnpforte errichtete. Die damaligen Spritzenmeister Anton Winkler und
Johann Staud erhielten für ihre Tätigkeiten, die auch das Warten der
Löschgeräte umfasste, von der Gemeinde jährlich 10 Gulden. Erhielt
ein Einwohner des Fleckens das Bürgerrecht war er verpflichtet, zur
Vermehrung der gemeindlichen Löschgerätschaften, einen ledernen
Feuerlöscheimer zu stiften. Dadurch kamen im Jahresdurchschnitt 8
Ledereimer zu je einem Gulden und 30 Kreuzer in Gemeindebesitz. Die
jährlichen Ausgaben für die Unterhaltung der Geräte betrugen 40
Gulden. der
Lahnpforte errichtete. Die damaligen Spritzenmeister Anton Winkler und
Johann Staud erhielten für ihre Tätigkeiten, die auch das Warten der
Löschgeräte umfasste, von der Gemeinde jährlich 10 Gulden. Erhielt
ein Einwohner des Fleckens das Bürgerrecht war er verpflichtet, zur
Vermehrung der gemeindlichen Löschgerätschaften, einen ledernen
Feuerlöscheimer zu stiften. Dadurch kamen im Jahresdurchschnitt 8
Ledereimer zu je einem Gulden und 30 Kreuzer in Gemeindebesitz. Die
jährlichen Ausgaben für die Unterhaltung der Geräte betrugen 40
Gulden.
|