| Alte Stadtmauer der oberen Festungspforte entdeckt. Von Lydia Aumüller Bei den Tiefbauarbeiten am 23.12.2000 waren in der oberen Peter-Paul-Str. Mauereste der alten Villmarer Befestigungsanlage gefunden worden. Zieht man den Stadtplan des Trier Baumeisters Ravensteyn vom 23. Mai 1699 zu Rate, so handelte es sich bei dem Gemäuer um eine Seite des „Zwingers", einer Verbindungsmauer zwischen dem äußeren Tor und der "obre Pfort", auch Limburger Pforte genannt. Hier hinaus führte der Weg nach Limburg der im Mittelalter die Hauptverbindungsstraße war. Das aus Kalksteinen gemauerte Fundament befindet sich in der Mitte der Straße zwischen den Anwesen Willi Müller und I. Berger Peter- Paul-Straße. Die Länge der Mauer ist nicht bekannt, da nur ein Durchbruch der ca. 1.50 breiten Mauer zur notwendigen Verlegung einer Abwasserleiters zum neugelegten Kanal in einer Tiefe von ca. 2 Metern erfolgte. Wie sich herausstellte, bissen sich zunächst zwei kleine Bagger bei der Härte des Materials fast die Zähne aus . Selbst ein Kompressor war fehl am Platze. Eine dritte noch größen Maschine schaffte schließlich den Rest der Tiefbauarbeit. Ein Zeugnis dafür, dass unsere Vorfahren auf stabile Grundmauern ihrer Festungsanlagen Wert legten. Möglicherweise stammen diese aus dem 13. Jahrhundert, denn erstmals wird 1250 die Stadtmauer urkundlich erwähnt. Sie wurde mehrmals zerstört und nach 1359 neu errichtet. Neben dieser oberen Pforte hatte die Festungsmauer eine zweite Pforte zur Lahn ,sowie eine weitere in Richtung Weilburg ,genannt „Wiespforte", die ebenfalls durch einen „Zwinger" gesichert waren. Bei zunehmendem Verfall fielen im Jahre 1819 die ehemaligen Stadttore und ein Teil der Ringmauer der Spitzhacke zum Opfer. Im Jahre 1991 bei Kanalarbeiten in der Weilburger Strasse nahe dem Wohngebäude Ch. Lottermann und der Gaststätte „Germania" ebenfalls Grundmaurreste des Zwingers der „Wiespforte" vorgefunden. Villmarer Marmor als Baumaterial für Stadtmauer
Der Steinfachmann Gerhard Höhler, Villmar (rechts) übergibt Bürgermeister Hermann Hepp den von ihm polierten Marmorstein. Gerhard Höhler erklärte,: Der Werkstoff ist identisch mit dem in
Villmar Da Einzelheiten über den Bau der Stadtmauer nicht bekannt sind, kann nicht festgestellt werden, ob es ein Zufall ist, dass das obere Stadttor aus Kalksteinen gemauert wurde, oder ob man bewusst an dieser kritischen Stelle das härtere Baumaterial verwendet hat. Aus alten Chroniken war bisher bekannt, dass um 1505 eine" Kalkkauth" im Gemeindegebiet vorhanden war und um 1605 bunter Marmor in Villmar und grauer in Arfurt gebrochen wurde. Steinkreuze aus grauem Marmor wurden im 17., 18. und 19. Jahrhundert auf dem Friedhof an der Kirche aufgestellt. „Die jetzt gemachte Entdeckung ist für die Geschichte Villmars
sensationell", so Hermann Hepp, Bürgermeister und Vorsitzender
des Kuratoriums Lahn- Marmor- Museum- Verein" Villmar. Daher habe
er die maßstabgerechte Aufzeichnung dieses Bodenfundes durch das
bauleitende Ingenieurbüro veranlasst. |
 Während die alte Stadtmauer überwiegend aus Schalsteinen erbaut
wurde, fanden interessierte Beobachter der Arbeiten in der Höhe des
ehemaligen „Oberen Stadttores" ,dass hier als Baumaterial
überwiegend Kalkstein verwendet wurde, und zwar polierfähiger
Kalkstein, der inzwischen als Lahnmarmor berühmt geworden ist. Dem
Villmarer Steinexperten Gerhard Höhler ( Vorstandsmitglied des Lahn
– Marmor - Museums – Verein, Villmar) schlug das Herz höher, als
er die Steinquader näher betrachtete. Er stellte einige Steine
sicher, schnitt, schliff und polierte diese und stellte fest, dass es
sich um herrlichen dunkelgrauen Marmor mit Sedimenten, Seelilien und
Korallen handelte.
Während die alte Stadtmauer überwiegend aus Schalsteinen erbaut
wurde, fanden interessierte Beobachter der Arbeiten in der Höhe des
ehemaligen „Oberen Stadttores" ,dass hier als Baumaterial
überwiegend Kalkstein verwendet wurde, und zwar polierfähiger
Kalkstein, der inzwischen als Lahnmarmor berühmt geworden ist. Dem
Villmarer Steinexperten Gerhard Höhler ( Vorstandsmitglied des Lahn
– Marmor - Museums – Verein, Villmar) schlug das Herz höher, als
er die Steinquader näher betrachtete. Er stellte einige Steine
sicher, schnitt, schliff und polierte diese und stellte fest, dass es
sich um herrlichen dunkelgrauen Marmor mit Sedimenten, Seelilien und
Korallen handelte.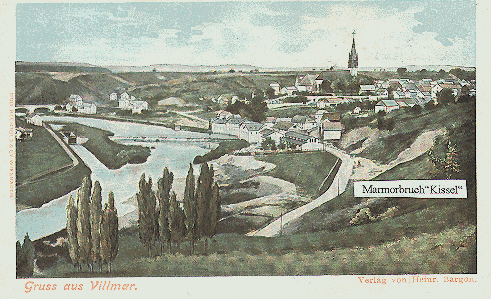 bekannten Marmor „Kissel" und stammt mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit aus dem Bruchgebiet „Kissel" in
dem bis Mitte des 20. Jahrhunderts Kalkstein gewonnen wurde".
Inzwischen sind diese Brüche verwaist und von Gestrüpp überwuchert.
Sie befinden sich an der linken Lahnhöhe, von der König- Konrad-
Halle flussabwärts in Richtung Runkel .
bekannten Marmor „Kissel" und stammt mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit aus dem Bruchgebiet „Kissel" in
dem bis Mitte des 20. Jahrhunderts Kalkstein gewonnen wurde".
Inzwischen sind diese Brüche verwaist und von Gestrüpp überwuchert.
Sie befinden sich an der linken Lahnhöhe, von der König- Konrad-
Halle flussabwärts in Richtung Runkel .